Типикон: Die Satzung, die fast niemand gelesen hat, aber alle befolgen
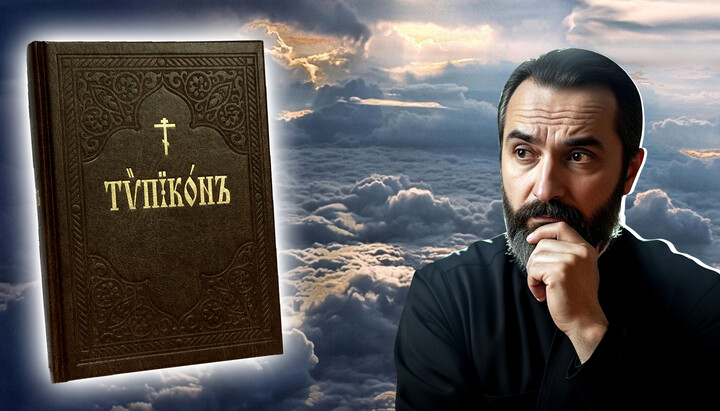
Es wird selten gelesen, noch seltener verstanden und im besten Fall fragmentarisch ausgeführt. Was muss man über das Hauptgottesdienstbuch wissen, um nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist zu dienen?
```html
Typikon – ein paradoxes Buch. Einerseits basiert der gesamte kirchliche Gottesdienst darauf, andererseits trifft man selbst unter Geistlichen und Statutenkennern selten jemanden, der es tatsächlich geöffnet hat und damit umzugehen weiß. Es bestimmt die Fastendisziplin und die Struktur des Kirchenjahres, bleibt dabei jedoch fast unbekannt. Es wird selten gelesen, noch seltener verstanden und im besten Fall fragmentarisch ausgeführt.
Viele seiner Regeln haben heute entweder ihre Aktualität verloren, werden kaum angewendet oder sind so formalisiert, dass sie die innere Logik des Statuts nicht mehr ausdrücken. Wie man nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist dient, darüber denken nur wenige nach.
Es ist unmöglich, in einem Artikel die ganze Vielfalt der Nuancen zu erfassen, die mit der Anwendung des Typikons verbunden sind. Deshalb beginnen wir heute mit einer kurzen Geschichte der Entstehung und des Inhalts dieses Buches.
Bereits in diesem Stadium wird deutlich: Um das Statut vernünftig und verantwortungsbewusst anzuwenden, reicht es nicht aus, nur die Regeln zu kennen – man muss ihren Sinn verstehen und unterscheiden können, was im Gottesdienst wichtig und was nebensächlich ist.
In Zukunft werden wir noch oft auf Themen zurückkommen, die mit dem Typikon verbunden sind, um Schritt für Schritt zu klären, wo sich darin historisch gewachsene Traditionen, wo die private Disziplin eines einzelnen Klosters und wo lebendige gesamtkirchliche Erfahrungen befinden.
Es gibt viele Statuten, aber nur ein Typikon
Beginnen wir damit, dass das Typikon nicht das einzige seiner Art ist. Geschriebene Statuten beginnen gleichzeitig mit der Entwicklung des Mönchtums zu erscheinen. Jedes große Kloster oder Klostergruppe hatte seine eigenen Statuten, was bedeutet, dass sie ihre eigenen Ordnungen der Dienste, Fastenregeln, Tagesabläufe und Verhaltensweisen hatten.
Das bekannte Sprichwort «mit seinem eigenen Statut geht man nicht in ein fremdes Kloster» beschreibt gut die Realitäten, in denen die Kirche den größten Teil ihrer Geschichte lebte.
Auch die Pfarrkirchen hatten ihre eigenen Ordnungen, jedoch konnten sich nur Klöster, als Bollwerke der Bildung und Schriftlichkeit ihrer Zeit, leisten, schriftliche Statuten zu erstellen. Deshalb haben wir praktisch keine erhaltenen Typika von Pfarrkirchen, trotz einzelner Erwähnungen über bestehende Unterschiede.
Man muss verstehen, dass die alten Mönchsgemeinschaften Palästinas oder Ägyptens in ihrer Anzahl selbst mit den bekanntesten Klöstern unserer Zeit unvergleichlich sind. Ganze Mönchsstädte, die Hunderte, manchmal Tausende von Menschen zählten, benötigten Gesetze, die Alltag, Wirtschaft, Gottesdienst und Disziplin regelten.
Zu den bekanntesten alten Statuten gehören das Statut des ehrwürdigen Pachomius des Großen (318 n. Chr.) für das Kloster in Tabenisi (Ägypten), «Großer Asketikon» des heiligen Basilius des Großen, «Konstitutionen» des ehrwürdigen Johannes Cassianus des Römers und das Statut des ehrwürdigen Benedikt von Nursia (6. Jahrhundert).
Aber das bekannteste und am weitesten entwickelte Statut war das der Lavra des ehrwürdigen Sabbas des Geheiligten, die in der Nähe von Jerusalem lag, weshalb dieses Statut auch Jerusalemer Statut genannt wird. Doch im 7. Jahrhundert, nach der Eroberung Palästinas durch die Perser und dann die Araber, wurde das kirchliche Leben gestört und das ursprüngliche Jerusalemer Statut ging verloren, obwohl es in verschiedenen Redaktionen erhalten blieb.
Ein weiteres Zentrum des kirchlichen Lebens war Konstantinopel. Das bekannteste Kloster hier war das Studion. Sein gottesdienstliches Statut war etwas einfacher und die Fasten leichter. Es gab auch ein besonderes Patriarchalisches Statut der Großen Kirche, das sich durch besondere Feierlichkeit auszeichnete. Es ist für uns besonders interessant, da es Einfluss auf das Athos-Statut hatte, das wiederum vom ehrwürdigen Theodosius von Pechersk nach Russland gebracht wurde und mit der Zeit zur Grundlage sowohl für Klöster als auch für Pfarreien wurde.
Diese Geschichte endete nicht. Nach dem Fall von Byzanz wurde das Studion-Statut überall durch das Jerusalemer ersetzt. Derselbe Prozess fand ab dem 14. Jahrhundert auch in Russland statt.
Wie wir sehen, ist das Statut, das heute in unserer Kirche angenommen wird, das Ergebnis eines langen historischen Prozesses, in dem byzantinische, studionische, athonitische und jerusalemer Traditionen miteinander verflochten sind.
Ein wenig über die Etymologie
Heute ist das Hauptstatutenbuch uns als Typikon bekannt, und sein vollständiger Titel lautet: «Typikon, das heißt das Bild der kirchlichen Nachfolge in Jerusalem, in der heiligen Lavra unseres ehrwürdigen und gotttragenden Vaters Sabbas...»
Bemerkenswert ist, wie die Autoren ihre Werke selbst nannten. Der ehrwürdige Sabbas – «Vorbild, Überlieferung und Gesetz», der ehrwürdige Theodor Studites – «Abbild» (Hinweis auf die Darstellung des höheren Plans in der irdischen Ordnung). All diese Bezeichnungen sind mit dem griechischen Begriff τύπος – Typ, Form, Muster verbunden. Später erhielt dieses Wort die Bedeutung von Gesetz oder Verordnung, obwohl es im Wesentlichen Τυπικόν – «nach dem Muster erstellt» bedeutet.
Genau dieses Verständnis des Typikons als Muster liegt ihm zugrunde. Es weist auf das Ideal hin, auf die himmlische Ordnung, die möglicherweise nicht in ihrer Fülle erfüllt werden kann, ebenso wie das Evangeliumsgesetz.
Das Typikon zeigt das Muster und die statutarische Logik, der man nachstreben sollte.
Ist das Klosterstatut in der Pfarrei anwendbar?
Man darf nicht aus den Augen verlieren, dass das Typikon, das in unserer Kirche angenommen wurde, seinem Ursprung nach ein Klosterstatut ist. Darin finden wir Anweisungen darüber, wann man die Stäbe ablegen soll, wie man Mönche weckt, wie man in den Gehorsamsdiensten arbeitet und sich bei der Mahlzeit verhält.
Das Statut wurde entwickelt, um das Leben der Mönchsgemeinschaft in bestimmten historischen, klimatischen und kulturellen Realitäten zu organisieren. Und natürlich ist es nicht für das Gemeindeleben des modernen Laien gedacht. Dennoch wurde es zur Grundlage der gottesdienstlichen und fastenpraktischen Praxis überall, was unvermeidlich Spannungen zwischen den Anforderungen des Statuts und den realen Möglichkeiten hervorrief.
So regelt das Typikon unser Leben sehr bedingt, bleibt aber ein großes Denkmal liturgischen Denkens. Immer offensichtlicher wird die Notwendigkeit, ein aktuelles gottesdienstliches Statut zu schaffen, das der modernen kirchlichen Realität angemessen ist.
Es geht nicht um die Zerstörung der Tradition, sondern um ihre sinnvolle Fortsetzung, denn nicht die Kirche existiert für das Typikon, sondern das Typikon für die Kirche.
Ein solcher Prozess ist nur möglich, wenn Reife, Wissen, theologische Kultur und allgemeine liturgische Bildung sowohl des Klerus als auch der Laien vorhanden sind. Deshalb benötigen wir eine aufmerksame und durchdachte Untersuchung des Typikons als lebendige Überlieferung der Kirche.
```









